Die Finanzfrage
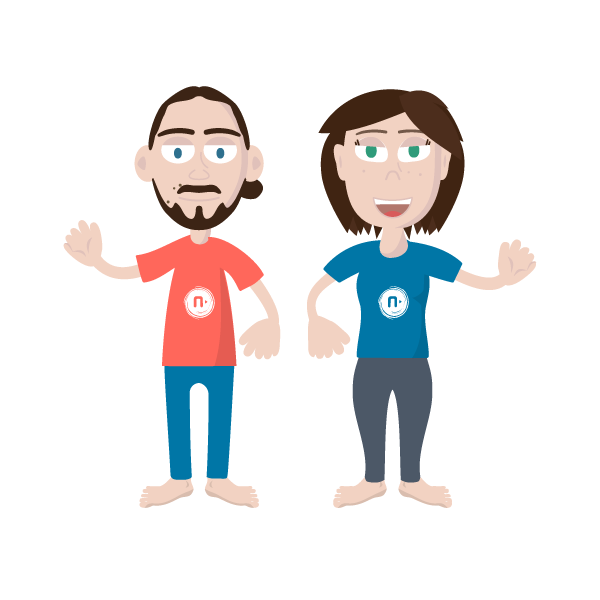
Pausenzeit
Bis hierhin hast du schon einiges gelesen und verarbeitet. Wahrscheinlich sind auch schon ein paar Stunden vergangen, seitdem du dich heute vor den PC gesetzt hast.
Wir finden: eine bisschen Dehnen tut immer gut. Stell dich ruhig einmal hin, drehe eine Runde durch den Raum und strecke dich ganz nach oben und dann ganz nach unten.
Die Finanzfrage
Eine der wichtigsten Aspekte zur Finanzierung von Projekten ist vor allem, dass im Unikontext auch ohne Finanzierung unglaublich viel möglich ist.
Initiativen sind ein Ort, in dem Menschen das lernen können, was sie im Studium oft nicht lernen, aber gerne lernen möchten. Das bedeutet oft reale Verantwortung zu übernehmen, kann aber natürlich viele Gründe haben.
Initiativenarbeit findet meistens ehrenamtlich und mit geringem Budget statt. Das ist nicht immer schlimm und führt zu viel Freiheit und Raum zum Ausprobieren. Gleichzeitig ist es auch wichtig, eine Haltung zu entwickeln in der klar ist: Die Arbeit, die wir tun ist finanzierungswürdig!
Diese Haltung ist für die Projektfinanzierung aber auch für die Projektdurchführung (unabhängig von der Finanzierung) wichtig.
Zwei Aspekte zur Finanzierung solltest du präsent haben:

-
Es gibt viele Möglichkeiten
Das Hochschulumfeld bietet (vor allem bei kleinen Beträgen) einen sehr guten Rahmen, um ohne große Verpflichtungen mit wenig Aufwand Geld zu beantragen.
-
Finanzierung heißt nicht gleich Geld
"Bezahlung" in ECTS kann auch eine super Möglichkeit sein, um die ehrenamtliche Arbeit neben (bzw. im Studium) zu ermöglichen. Das hat vor allem auch den Vorteil, dass sich dadurch mehr Studierende leisten können, Initiativenarbeit zu machen. Diversität in Hochschulgruppen ist schließlich ein Thema, an dem wir alle arbeiten sollten! Oft gibt es über den Career Service oder andere institutsübergreifende Einrichtungen die Möglichkeit für studentisch organisierte Seminare ECTS zu erreichen. Mache aus deiner Initiative ein Seminar. Alle, die ein Semester mitarbeiten, erhalten im Wahlbereich oder den Schlüsselqualifikationen eine bestimmte Anzahl an ECTS. Frage einfach bei den entsprechenden Instituten mal an!
Einen Finanzantrag stellen
Einen Finanzantrag zu stellen (oder einen Antrag auf stud. Hilfskräfte, Sponsoring, usw.) ist gar nicht so schwer, wie es auf den ersten Blick wirken mag. Wir geben dir hier eine Step-by-step Anleitung dafür an die Hand.

Was ist der Bedarf?
Brauchst du Geld für Redner*innen oder Workshops? Geld für eine Abschlussparty? Ist der Bedarf studentische Hilfskräfte, da das Projekt “nur” im Ehrenamt nicht umgesetzt werden kann oder die Gruppe das nicht will? Braucht es Sachspenden für einen Willkommens-Brunch?
Werde dir darüber bewusst, was für dein Projekt/die Idee aktuell gebraucht wird. Nur wenn klar ist, was du brauchst, kannst du das kommunizieren. Das klingt womöglich lingt banal, aber daran kann es immer wieder scheitern. Das kann Geld sein, aber wie oben erwähnt auch stud. Hilfskräfte oder Sachspenden.
Schritt 7
Wir arbeiten jetzt an einem beispielhaften Projekt. Mach hierfür gerne ein digitales Dokument auf, in dem du gleich arbeiten kannst.
Schreibe den (fiktiven) Bedarf so konkret wie möglich in einem Dokument auf.

Wen kann man anfragen?
Die Einfluss-Interessen-Matrix kann dabei helfen, zu entscheiden, wen du für was anfragst, denn hier stehen im Idealfall auch alle potenziellen Geldgeber*innen.
Suche dir zu Übungszwecken zwei Kärtchen der Matrix heraus. Am besten jeweils eine Person/Organ aus dem Kästchen unten rechts und aus dem Kästchen oben links.
Wenn du dir nicht sicher bist, an wen du den Finanzantrag schreiben möchtest, bietet es sich an, einfach mal dem AStA/StuRa/StuPa und dem*r Rektor*in zu schreiben. Vor allem beim AStA gibt es an den meisten Hochschulen die Möglichkeit sehr niederschwellig Geld zu erhalten, und du kannst den Antrag ggf. tatsächlich abschicken.
Kurz und knackig halten!
Es ist wichtig, dass Personen, von denen du etwas forderst, in kurzer (Lese)Zeit erfahren kann, wer du bist und was du machst. Es bietet sich dafür an den Basissatz zu benutzen. Er eignet sich für den Anfang, denn hier hast du die Idee schon einmal auf den Punkt gebracht.
Du kannst je nach Person, der du schreibst, den Basissatz anpassen und den Fokus auf das lenken, was die Person am spannendsten finden könnte. Anschließend formulierst du, angepasst an die Person, das Anliegen.
Ganz wichtig: Werde konkret! Und vergiss nicht zu formulieren, was du konkret brauchst und was aus deiner Perspektive der nächste Schritt in der vielleicht beginnenden Kooperation ist.

Schritt 8
Suche dir die zwei Personen/Organe heraus, für die du einen Finanzantrag (oder einen Antrag für einen anderen Bedarf) schreiben möchtest.
Schreibe dann für den Bedarf, den du formuliert hast, jeweils einen Antrag an die zwei Personen/Organe. Du kannst die Anträge gerne als direkte Mail schreiben. Benutze in beiden Fällen den gleichen Bedarf.

Ein kleiner Vergleich
Wenn du fertig bist, vergleiche die beiden Anträge.
Welche Unterschiede fallen auf? Welche Aspekte der Idee hast du bei welchem Akteur genannt? Welche Aspekte der Idee hast du nicht benannt? Wie unterscheidet sich die Sprache? Ist sie ähnlich formal? Unterstellst du den Akteur*innen in den Anträgen unterschiedliche Dinge? Was sind diese Annahmen?
Notiere die deine Gedanken dazu gerne auf deinem Zettel, dann kannst du sie für zukünftige Anträge einbeziehen.
Schritt 9
Trau dich, den Antrag und die formulierten Ideen einfach mal abzuschicken und somit in die Unistrukturen zu geben! Vor allem an eine Person/Organ aus dem Kästchen unten rechts der Matrix kann wenig schiefgehen.