Die Soziale Norm
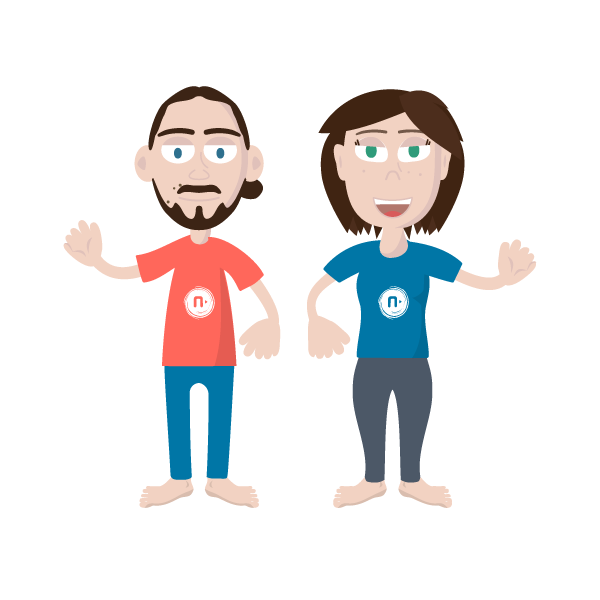
Pausenzeit
Bis hierhin hast du schon einiges gelesen und verarbeitet. Wahrscheinlich sind auch schon ein paar Stunden vergangen, seitdem du dich heute vor den PC gesetzt hast.
Wir finden: eine bisschen Dehnen tut immer gut. Stell dich ruhig einmal hin, drehe eine Runde durch den Raum und strecke dich ganz nach oben und dann ganz nach unten.

2. Soziale Normen
Der Einfluss der anderen
Was sind soziale Normen?
Soziale Normen sind Regeln und Standards, die von vielen Menschen geteilt werden und so das Verhalten von einzelnen Menschen lenken, ohne dafür Gesetze zu benötigen. Sie deuten mir an, wie ich mich in einer bestimmten Situation verhalten sollte. Die psychologische Forschung zeigt, dass sie einen nennenswerten Einfluss auf unser Verhalten haben können und daher auch für umweltrelevantes Verhalten wichtig sind.
Zu den sozialen Normen gehört zum Beispiel die subjektive Norm. Diese entsteht aus den Annahmen über Erwartungen von Menschen, die für uns selbst bedeutsam sind. Ein Beispiel wäre: „Was würden meine Eltern sagen, wenn ich dies oder jenes tue?“. Das psychologische Modell zur Erklärung nachhaltigen Handelns beruht zum Teil auf der Theorie des geplanten Verhaltens, die diese subjektive Norm als einzigen Normbegriff einbezieht. Allerdings wäre es nicht weit genug gedacht, nur die subjektive Norm in das Modell mit aufzunehmen. Wir werden nämlich auch von Menschen beeinflusst, mit denen wir wenig oder nichts zu tun haben, die einfach nur in unserem Umfeld sind, ohne dass sie uns etwas bedeuten. In der psychologischen Literatur gibt es daher eine weitere Einteilung sozialer Normen: Soll- und Ist-Normen.
„Ich sollte mich umweltschützend verhalten.“
Soll-Normen sind moralische Regeln, die beschreiben, was wir in einer bestimmten Situation nach der Meinung anderer tun sollten.
Psycholog*innen sprechen hier von injunktiven Normen. Sie zeigen, ob ein Verhalten von der Gruppe anerkannt oder missbilligt wird. Wenn ich vor dem Kleiderschrank stehe und überlege, welche Kleidung andere für den Vortrag über Lebensmittelverschwendung für angemessen halten, mache ich mir Gedanken über eine Soll-Norm. Wenn ich einen Kongress besuche, bei dem kommuniziert wird, dass vegane Ernährung dort von den Teilnehmer*innen erwünscht ist, werde ich mit einer Soll-Norm konfrontiert. Soll-Normen können unterschiedliche Ausprägungen in verschiedenen Situationen haben. Beispielsweise vermittelt der Kongress wahrscheinlich andere Soll-Normen als mein Arbeitsplatz.
„Verhalten sich andere tatsächlich umweltschützend?“
Ist-Normen spiegeln das tatsächliche und verbreitete Verhalten von Menschen wider. Psycholog*innen sprechen von deskriptiven Normen.
Es ist wahrscheinlich, dass wir das machen, was wir bei anderen Menschen sehen. Auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind, imitieren wir ihr Verhalten bis zu einem gewissen Grad. Denn Ist-Normen zeigen, welches Verhalten sich für andere Menschen bewährt und signalisieren uns so häufig, wie wir unsere Ziele am effektivsten erreichen können. Ein von Menschen ausgetretener Pfad, der uns den Weg durch den Wald weist, ist beispielsweise eine Ist-Norm.
Der Einfluss von Soll- und Ist-Normen wird von den Handelnden selbst häufig unterschätzt und sogar Kommunikationsprofis beachten diesen Aspekt nicht immer. Die Berücksichtigung und Unterscheidung von Soll- und Ist-Normen ist dennoch wichtig, weil die verschiedenen Normen sich gerade im Umweltkontext widersprechen können. So könnte es sein, dass meine Freunde es gutheißen, Energie zu sparen und nachhaltig zu leben (Soll-Norm). Andererseits erlebe ich in meiner Familie, dass im Winter unsere Heizung hochgedreht und mit T-Shirt in der Wohnung herumgelaufen wird (Ist-Norm) und verhalte mich dann vielleicht auch in meiner eigenen Wohnung so.

Wie können wir soziale Normen richtig anwenden?
SOLL- und IST-Normen gekonnt einbeziehen
Als Umweltschützer*innen haben wir die Möglichkeit, Soll- und Ist- Normen in einer bestimmten Situation hervorzuheben (Psycholog*innen nennen dies „salient machen“), um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Menschen ein umweltfreundliches Verhalten zeigen. An dieser Stelle möchten wir betonen, dass wir uns damit am Rande zur Manipulation befinden und raten, die nachfolgenden Zeilen kritisch zu hinterfragen.
Eigentlich ist das gekonnte Einbeziehen und Kommunizieren von Normen sehr einfach. Der Grundsatz ist: Sprechen sich viele Menschen positiv für den Umweltschutz aus (Soll-Norm) oder verhalten sie sich umweltfreundlich (Ist-Norm), ist es sinnvoll, diese Meinungen und Verhaltensweisen auch hervorzuheben und z. B. in Informationsbroschüren anzusprechen oder in Videos zu veranschaulichen.
Sprechen Soll- und Ist-Normen gegen den Umweltschutz, sollten sie lieber unerwähnt bleiben. Das klingt einfach, wird aber häufig nicht beachtet und kann sogar dazu führen, dass meine Botschaft negative Auswirkungen hat. Beispielsweise steckt in der Aussage „Viele Menschen schmeißen ihren Müll auf den Gehweg – sei keiner davon!“ die unterschwellige Ist-Norm-Aussage, dass viele Menschen Müll auf den Gehweg schmeißen.
Diese Aussage erweckt den Eindruck, dass es in der Tat okay ist, Müll nicht in den Mülleimer zu werfen, da es viele andere Menschen genauso tun. Viele Ökostromanbieter verwenden soziale Normen hingegen schon sehr gekonnt. Sie geben z. B. nicht an, wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung bereits Ökostrom bezieht, da es noch eine Minderheit ist und demnach die Ist-Norm zur jetzigen Zeit gegen Ökostrom spricht. Stattdessen heben sie die Vorteile von Ökostrom für ökologische Nachhaltigkeit hervor, betonen die Akzeptanz von Erneuerbaren Energien in der Bevölkerung (Soll-Norm) und werben mit einer anderen Ist-Norm: dem Anstieg der Zahl von Ökostromkund*innen. Angaben über soziale Normen sollten immer auf wahren Zahlen und Statistiken basieren. Als Umweltschützer*innen wollen wir keinen falschen Schein erwecken, sondern bereits positive Entwicklungen hin zu einer ganzheitlich nachhaltigen Lebensweise hervorheben und fördern.

Im besten Fall werden Soll- und Ist-Normen nur fokussiert, wenn sie für umweltschonendes Verhalten sprechen.
Soll- und Ist-Normen in Kombination anwenden
Auch die Kombination von Soll- und Ist-Normen ist wichtig. Sprechen sie beide für umweltschützendes Verhalten, ist es sinnvoll, auch beide Normen hervorzuheben. So haben z. B. Hamann und Kollegen herausgefunden, dass die Kombination aus einer Ist-Norm (viele Nachbars-Briefkästen haben bereits Sticker) und einer Soll-Norm („wir sollten uns als Nachbarschaft für den Umweltschutz einsetzen“) besonders effektiv ist – in diesem Fall haben die meisten Briefkastenbesitzer*innen einen Aufkleber angebracht. Wie angesprochen, können sich Ist- und Soll-Normen jedoch auch widersprechen und so unerwartete negative Auswirkungen erzielen.
Ein gutes Beispiel ist der Iron-Eye-Cody Spot, der in den USA als eine der besten Werbungen für den Umweltschutz angesehen wurde. In dem Video ist ein indigener Mann zu sehen, der auf einem Fluss, umgeben von schöner Natur, in eine industrielle und verschmutzte Umgebung paddelt und am Ende eine Träne vergießt. Die von den Macher*innen gewollte Soll-Norm-Aussage ist: „Schützt die Umwelt, sie ist uns viel wert!“ Die unterschwellige und widersprechende Ist-Norm-Aussage jedoch ist: „Amerika ist verschmutzt und da viele dafür verantwortlich sind, musst du dich nicht schlecht fühlen, wenn du es auch machst.“ In diesem Spot haben die Produzent*innen deshalb aus psychologischer Sicht neben einer Betonung der Soll-Norm unerwünscht auch eine Ist-Norm betont, was Zweifel aufkommen lässt, ob der Spot bewirken kann, worauf er abzielt.
Interessanterweise können Ist-Normen ungewollte Boomerang-Effekte erzeugen. Wenn die Ist-Norm umweltschützend ist (z. B. viele Bürger*innen der Nachbarschaft sich stromsparend verhalten), bewegt sie auf der einen Seite viele, bisher wenig umweltschützende Menschen dazu, sich dieser Norm anzupassen (und mehr Strom zu sparen). Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Personengruppe, deren Verhalten schon stark umweltschützend ist (weil sie sehr wenig Strom verbrauchen). Wenn diese Gruppe lediglich zurückgemeldet bekäme, dass sie ungewöhnlich viel Strom spart, könnte sie im Sinne einer Anpassung an die Ist-Norm infolgedessen mehr Strom verbrauchen als zuvor, sich also weniger umweltschützend verhalten. Dies ist der sogenannte Boomerang-Effekt. Dem Boomerang-Effekt können wir entgegenwirken, indem wir zusätzlich eine Soll-Norm ins Spiel bringen und erwähnen, dass z. B. „in der Nachbarschaft Stromsparen verbreitet ist und gut geheißen wird“. In einer zu unserem Beispiel passenden Studie wurde einer Ist-Norm-Nachricht ein Smiley beigefügt, der die Soll-Norm vermittelte. Er verhinderte nachweislich, dass die Top-Energiesparer*innen sich ihren weniger energiesparenden Nachbar*innen anpassten. Diese Ergebnisse betonen, wie wichtig es ist, bereits umweltfreundliche Verhaltensweisen wertzuschätzen.

Wenn Soll- und Ist-Norm beide für das Umweltschutzverhalten sprechen, sollten wir sie unbedingt hervorheben.
Vorbildverhalten
Eine Methode, um umweltschützende Normen aufzuzeigen, ist soziales Modellverhalten. Es hat sich in der Psychologie als erfolgreiche Strategie erwiesen, um Umweltschutzverhalten zu fördern. Soziales Modellverhalten im Umweltschutz bedeutet, einen nachhaltigen Lebensstil vorzuleben. Die nachhaltige Lebensweise muss hierfür nicht direkt beobachtet werden, sie kann sich z. B. auch in Gesprächen herauskristallisieren. Wichtig ist dabei, dass das Gespräch keinen missionarischen Charakter hat. Sonst wird wahrscheinlich eine Trotzreaktion, die sogenannte Reaktanz, einer möglichen Veränderungsmotivation entgegenwirken. Das Vorbild kann sowohl eine berühmte Person des öffentlichen Lebens als auch jede*r von uns sein.
Beispielsweise können wir uns eine Umweltkampagne mit Sportler*innen als Vorbilder vorstellen, die für eine gesunde und fleischarme Ernährung werben. Hier ist allerdings anzumerken, dass der Einsatz von attraktiven Befürworter*innen eher ein Mittel ist, um uns bei der Entscheidung zwischen Marke A und B zu beeinflussen und keine erfolgreiche Methode, um tiefgreifenden Lebensstilwandel zu bewirken. Die vorgeschlagene Kampagne ist also eher Teil einer Gesamtstrategie und würde vor allem Menschen bestärken, die nachhaltige Ernährung schon gut finden oder bereits Schritte in diese Richtung gemacht haben. Darüber hinaus sollten auch Interessen und Ehrlichkeit der Beteiligten hinterfragt werden.
Ein gelungenes Beispiel für die Verwendung von Vorbildern ist die Kampagne „Stop talking. Start planting.“ der Kinder- und Jugendinitiative Plant-for-the-Planet. Bei dieser Kampagne halten Kinder-Botschafter*innen für Klimagerechtigkeit berühmten Erwachsenen, wie Felipe von Spanien, Peter Maffay oder Oliver Kalkofe, den Mund zu. Die Nachricht dabei ist, dass Umweltschutz nicht nur durch reden, sondern durch aktives Engagement gefördert werden kann. In dieser Kampagne treten nicht die prominenten Menschen, sondern die Kinder als Vorbilder auf.
Eine kleinere, aber deshalb nicht weniger bedeutende, Methode ist die Verbreitung von nachhaltigen Verhaltensweisen durch einzelne nicht berühmte Vorbilder. Bei vielen Organisationen (z. B. Plant-for-the-Planet oder Lebensmittelretter) gibt es mittlerweile sogenannte Botschafter*innen, die für die Verbreitung der Aktion in ihrer Region zuständig sind und als Vorbild voranschreiten. Darüber hinaus können wir uns auch selbst als Multiplikator*innen nachhaltiger Lebensstile verstehen. Wenn wir zu Nachhaltigkeit ermutigen möchten, sollten wir uns selbst gegenüber anderen möglichst offensichtlich nachhaltig verhalten und Verhaltensspuren hinterlassen. So legt zum Beispiel Niki Harré, die Autorin von „Psychology for a Better World“, ihren Fahrradhelm demonstrativ auf ihren Büroschreibtisch, damit er anderen Menschen ihre nachhaltige Verkehrsmittelwahl signalisiert.
Selbst wenn wir manchmal das Gefühl haben, nicht genug bewirken zu können, erreichen wir unbewusst doch vieles. Leben wir nachhaltige Verhaltensweisen vor anderen sichtbar und mit Überzeugung aus, so haben wir eine positive Auswirkung auf das Verhalten der Leute, die uns umgeben.
Umweltverhalten kann gefördert werden, indem es von anderen Menschen vorgelebt wird.
Minderheiteneinfluss nutzen
In den bisherigen Abschnitten zu sozialen Normen wurde vor allem der Einfluss sozialer Mehrheiten betont. Allerdings können sich auch Minderheitenmeinungen auf das individuelle Umweltverhalten auswirken. Als Umweltschützer*innen befinden wir uns häufig in einem Umfeld, in dem wir in der Minderheit sind. Obwohl unsere soziale Gruppe entsprechend kleiner ist, sollte ihr Einfluss jedoch nicht unterschätzt werden. Nicht selten werden Vorschläge, die wir zu vermitteln versuchen, im ersten Moment von der Mehrheit abgelehnt (z. B. wenn ich die Einführung von Recycling-Papier für das Drucken an meiner Arbeitsstelle fordere).
Allerdings zeigt Forschung zu Minderheiteneinflüssen, dass solche Nachrichten häufig im Stillen verarbeitet werden und ihre Wirkung dann verspätet zeigen. Daraus lässt sich schließen, dass der erste Anschein, ein Veränderungsversuch sei missglückt, auch trügen kann. Da die Umweltschutzthematik häufig von einer Minderheit zur Sprache gebracht wird, sollten wir einige Hinweise beachten, damit die Aussagen als relevant und glaubwürdig anerkannt werden. Aussagen sollten stimmig sein und eher auf Fakten als auf Meinungen basieren. Zusätzlich reicht häufig schon ein weiterer Befürworter oder eine weitere Befürworterin aus, um andere zum Nachdenken zu bringen. Dies trifft besonders dann zu, wenn die anderen davon ausgehen, dass der oder die Befürworter*in genauso wie sie in der Regel die Mehrheitsmeinung vertritt.
Auch in Situationen, in denen Umweltschutz eine Minderheitenmeinung darstellt, sollten Umweltschützer*innen sich nicht entmutigen lassen.
Abgelehnte Vorschläge können (zunächst) unsichtbare Effekte haben. Es ist hilfreich, andere Befürworter*innen zu gewinnen und sachlich zu argumentieren.