Nachaltige Entwicklung in der Praxis
Wie setzen wir Nachhaltigkeit um?
Nachdem wir uns angesehen haben, auf welchen theoretischen Grundlagen Nachhaltige Entwicklung fußt, erfährst du hier mehr über die aktuell wichtigsten Programme und Instrumente, mit denen Nachhaltige Entwicklung umgesetzt werden (soll).
Die UN-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals)
Anders als noch bei den MDGs – Millenium Development Goals (2000 – 2015) – wird bei den SDGs (2015 – 2030) der menschliche Entwicklungsbegriff (Gesundheit, Armut, Bildung, Geschlechtergerechtigkeit etc.) mit den ökologischen Nachhaltigkeitsfragen verknüpft.
Wie wir bereits weiter oben festgestellt haben, entspricht dies nun endlich auch den umfassenden Ansprüchen des Nachhaltigkeitsbegriffs, der sowohl die ökologischen Grundlagen erfüllen muss, als auch die Chance bieten muss, menschliche Entwicklung zu ermöglichen.
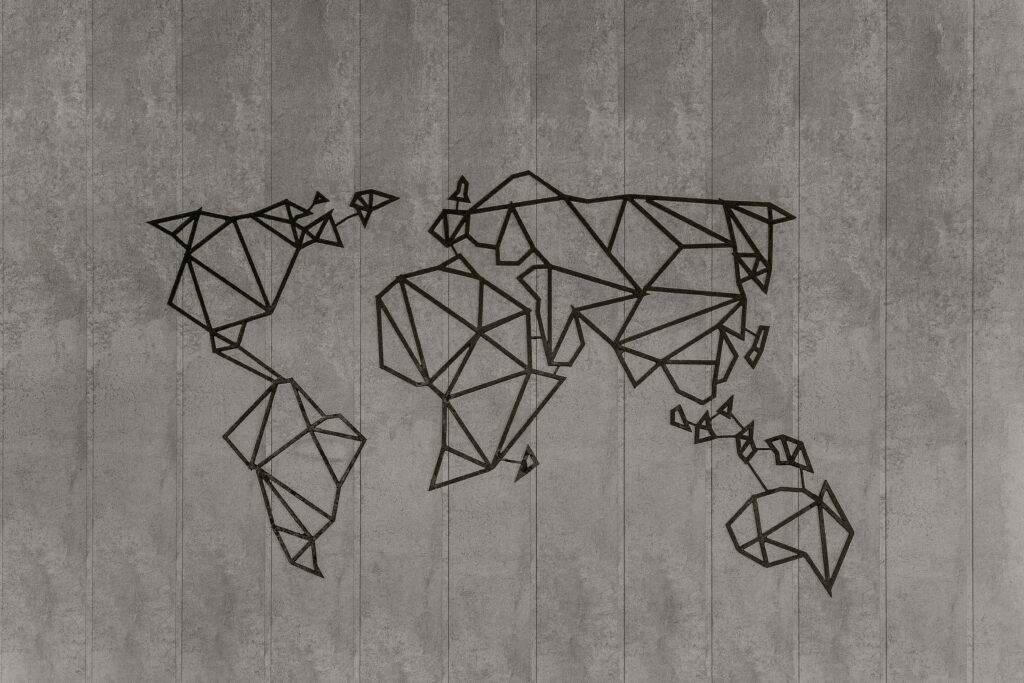

Darüber hinaus befassen sich die SDGs zwar weiterhin zu einem gewissen Teil (wie die MDGs) mit den Entwicklungschancen des globalen Südens.Ein Paradigmenwechsel fand aber auch hier zu einem gewissen Grad statt, welcher das Bild der klassichen “Entwicklungsländer” auflöst.
Durch die Tatsache, dass die Industrieländer des Globalen Nordens maßgeblich für die bisherige und zukünftige Umweltbelastung verantwortlich sind, werden auch sie als Entwicklungsländer verstanden, die ihre Wirtschaft und Gesellschaftsformen entsprechend einer Nachhaltigen Entwicklung anpassen müssen.
Mit 17 Zielen und insgesamt 169 Unterzielen geben die SDGs den Regierungen weltweit relativ klare Handlungsanweisungen, die globalen Probleme des 21. Jahrhunderts gemeinschaftlich zu lösen. Einen Überblick über die SDGs findest du hier:
Schau dich hier mal umWenn du das Thema noch ein wenig vertiefen und die Verbindung zu den planetaren Grenzen besser verstehen möchtest, kannst du hier einen kurzen Vortrag von Johann Rockström anschauen.
Schritt 11
Zurück zum Zettel: Vergleiche die Ziele der SDGs mit den von dir notierten Aspekten Nachhaltiger Entwicklung vom Anfang des Moduls.
Ordne sie den SDGs zu. Welche Herausforderungen fallen dir dabei (auch mit Rückblick auf die Konzepte Nachhaltiger Entwicklung) auf? Wo könnte es zu Problemen bei der Umsetzung bzw. zu Zielkonflikten kommen?

Einen spannenden Ansatz zur Messung der SDGs auf nationaler Ebene findest du im Projekt SDG watch. Hier wird auch dafür plädiert, dass Deutschland sich den Zielen akribischer verschreiben muss.
Neue Wohlstandsindiktoren
Ziel nachhaltiger Entwicklung ist es auch, Menschlichen Wohlstand für ein gutes Leben zu schaffen und zu halten. Aber wie Messen wir eigentlich unseren Wohlstand?
Insbesondere in westlichen Industrienationen (aber mittlerweile quasi weltweit) wird meist noch das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als Indikator Gesellschaftlichen Fortschritts und Entwicklung herangezogen. Vereinfacht werden hier alle Wirtschaftsleistungen gemessen, die erbracht wurden. Steigen sie, so wird das bis heute als positive Entwicklung für ein Land oder eine Region gewertet.
Kritik an der übermäßigen Bedeutung des BIP ist vielfältig: Soziale Ungleichheiten, Umweltzerstörungen (insbesondere durch Externalisierung von schädlichen Wirtschaftsleistungen), Gesundheit etc. werden zumindest nicht direkt in das BIP mitgerechnet. Damit ist natürlich höchst fraglich, ob somit eine gute menschliche Entwicklung analysiert werden kann. Ein bisschen verhält es sich dann nämlich mit dem BIP so, als würde man ein Vorrangmodell der Nachhaltigkeit mit der Ökonomie im Zentrum entwickeln. Geht es der Wirtschaft gut – so die Annahme – können auch die anderen Bereiche profitieren.
Dabei gibt es aber auch zahlreiche Alternativen, die Versuchen, komplexere, ganzheitliche Ansätze zu fahren.
Im folgenden findest du 3 Beispiele. Informiere dich bei Interesse über die Modelle und vergleiche sie z.B. mit den Konzepten der Nachhaltigkeit. Wie unterscheiden sie sich untereinander?
„Buen Vivir”, ist die Übersetzung von dem Quechuanischen Ausdruck „Sumak Kawsay”, und bedeutet soviel wie „Gutes Leben“. Es umfasst eine Lebenseinstellung, ein Wertesystem und eine besondere Auffassung dessen, was wir in der westlichen Welt Wohlstand nennen. Hier bekommst du einen detaillierteren Einblick.
Der Name ist Programm: die Gemeinwohlökonomie vertritt eine Form des Wirtschaftens, die nicht primär dem Wachstum sondern nachhaltig-solidarische Kriterien in den Vordergrund stellt. Dafür wird eine sogennante Gemeinwohl-Bilanz genutzt. Was sich genau hinter dem Konzept verbirgt wird hier gut zusammengefasst.
Ein Forschungszweig, der sich damit beschäftigt, wie eine Welt aussehen könnte, wo nicht das BIP-Wachstum den Kern unserer Gesellschaftsordnung und unsere Idee von Fortschritt ausmacht – sondern das menschliche Glück und Wohlbefinden. Auf den ersten Blick ganz einfach, aber was sich alles hinter dem Konzept verbirgt kannst du hier nachlesen.
Die Doughnut Economy
Ein spannender Ansatz, der das Konzept der planetaren Grenzen um die Bedürfnisse menschlicher Entwicklung erweitert und in Einklang bringt ist die sogennante “Doughnut Economy” der Britischen Ökonomin Kate Raworth.
Sie kombiniert den Ansatz der planetaren Grenzen mit einer sozialen Perspektive und spricht sich aus für einen sicheren Ring für menschliche Existenz und ihr Handeln, welche innerhalb der ökologischen Kapazitäten Platz findet.