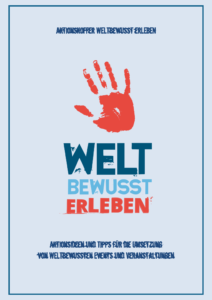Persönliche Ökologische Norm III

1.3 Selbstwirksamkeit
Das Vertrauen in unsere Fähigkeiten
Gerade im Umweltschutz kann das Gefühl aufkommen, dass die eigenen Handlungen nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Und wer glaubt, das eigene Verhalten habe keine relevanten Auswirkungen auf den Umweltschutz, für den oder die macht es „eh keinen Sinn, überhaupt umweltfreundlich zu handeln“. Deshalb ist es sehr wichtig, Menschen Selbstwirksamkeitserfahrungen zu ermöglichen.
Im Umweltkontext besteht Selbstwirksamkeit demnach aus Fähigkeiten, sich umweltschützend verhalten zu können, und einer Wahrnehmung der eigenen Kompetenz. Besuche ich zum Beispiel einen Reparaturworkshop für Haushaltsgeräte und traue mir daraufhin zu, meinen Staubsauger oder die elektrischen Haushaltsgeräte von anderen zu reparieren, habe ich eine hohe Selbstwirksamkeit in diesem Bereich. Ich bin dann stärker motiviert, nachhaltig zu handeln, weil ich Staubsauger, Stabmixer oder elektrische Waagen eigenständig reparieren kann, anstatt sie durch neue auszutauschen.
Unter Selbstwirksamkeit verstehen Psycholog*innen die Gewissheit, eine Anforderung mit den eigenen Fähigkeiten meistern zu können – ganz nach dem Motto „Ich werde es schaffen“.


Es lässt sich ein Zusammenhang finden zwischen dem Glauben, Einfluss auf Umweltprobleme zu haben, und politischem Engagement für Umweltthemen. In einem Überblicksartikel schrieben Forscher*innen, dass Selbstwirksamkeit wichtiger für das umweltschützende Verhalten ist als das Wissen der Versuchspersonen. Generell haben manche Menschen mehr Vertrauen in ihre Fähigkeiten als andere. Dennoch kann Selbstwirksamkeit bei allen gefördert werden. Insbesondere das Gefühl kollektiver Selbstwirksamkeit – also dass wir als Gruppe Herausforderungen gemeinsam meistern können – soll hier betont werden, da es umweltschützendes Verhalten stärker beeinflussen kann als individuelle Selbstwirksamkeit.
In anderen Worten: Wenn wir als Individuen fürchten, dass unser Verhalten nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, so können wir als Gruppe durchaus den Glauben haben, gemeinsam etwas zu erreichen.
Wichtig für Selbstwirksamkeit ist das Handlungswissen, also Wissen über Handlungsmöglichkeiten im jeweiligen Kontext. Im folgenden Abschnitt beziehen wir uns auf Handlungswissen. Es ist von dem bereits erläuterten Problemwissen abzugrenzen. Problemwissen beinhaltet Informationen über die negativen ökologischen Konsequenzen von nicht-umweltbewusstem Verhalten und sagt mir, warum ich mich umweltschützend verhalten sollte. Handlungswissen hingegen ist lösungsorientiert und beinhaltet Informationen darüber, wie ich mich umweltschützend verhalten kann und welche Verhaltensweisen wirksam sind.
Es ist wichtig, dass wir umweltfreundliche Handlungsmöglichkeiten und ihren Umwelteffekt kennen und bewerten können.
Wie fördern wir Selbstwirksamkeit?
Handlungsoptionen und ihre Effektivität aufzeigen
Um das Gefühl der Selbstwirksamkeit zu erhöhen, können wir andere Menschen mit dem nötigen Wissen über ihre Handlungsmöglichkeiten versorgen. Dazu müssen natürlich zunächst einmal Handlungsmöglichkeiten bestehen. Um Selbstwirksamkeit zu fördern, können Bürger und Bürgerinnen zum Beispiel Informationen über die bestehende umweltfreundliche Infrastruktur wie den öffentlichen Nahverkehr und Radwege erhalten. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn die Infrastruktur besser ist als von den meisten angenommen. Allein schon das Wissen über eine Auswahl von Verhaltensmöglichkeiten kann ein Gefühl der Kontrolle über die Situation und nachhaltiges Verhalten geben.

Darüber hinaus ist es wichtig, die Handelnden auch mit Wissen über die Effektivität der einzelnen Verhaltensweisen auszustatten. Wenn ich nur einen Katalog von Energiesparmaßnahmen bekomme, ohne zu wissen, welche Maßnahmen davon die größten Einsparpotenziale haben, fühle ich mich leicht überfordert. Da ich nicht das Gefühl von Kontrolle über die Situation habe, werde ich weniger geneigt sein, mein Verhalten zu ändern. Und tue ich es trotzdem, so fokussiere ich mich vielleicht nur auf das Lichtausschalten und lasse effektivere Maßnahmen wie eine Temperaturerhöhung des Kühlschrankes außer Acht.
Es ist wichtig, Informationen über die Wirksamkeit von Umweltschutzverhaltensweisen anzubieten, damit Handlungsentscheidungen unter dem Aspekt der Effektivität getroffen werden können. Statistiken sollten dabei wenn möglich in Einheiten pro Person angegeben werden, damit das Gefühl entsteht, einen Unterschied machen zu können.
Training von Kompetenzen
In manchen Fällen müssen wir Fähigkeiten für umweltschützendes Verhalten zuerst einüben. Dafür brauchen Handelnde geordnete Instruktionen, die ihnen zeigen, wie sie umweltgerechtes Verhalten ganz konkret ausführen können. Das sind z. B. Informationen, dass sich Fensterläden nutzen lassen, um das eigene Büro zu kühlen, da die Sonne von ihnen reflektiert wird, oder Hinweise, wie bestimmte Plastiksorten im Müll zu trennen sind.
Auch gemeinsame Aktionen des Erfahrungsaustauschs sind hilfreich. Das können z. B. vegetarische Kochabende sein oder gemeinsame Arbeit in Fahrradwerkstätten und Gemeinschaftsgärten. Dieser Erfahrungsaustausch ist eine gute Möglichkeit, um Kompetenzen zu vermitteln und nachhaltiges Verhalten zu erleichtern. Neben dem Trainingseffekt haben wir hier wieder die Möglichkeit zu Selbstwirksamkeitserfahrung sowie zum Erleben von sozialen Zugehörigkeitsgefühlen und positiven Emotionen, die wir mit nachhaltigem Handeln verknüpfen.
Die BUNDjugend verbindet beispielsweise in ihrem Projekt »WELTbewusst erLEBEN« Vorträge mit thematisch passenden Aktionen. So können die Teilnehmenden im Anschluss an Veranstaltungen z. B. vegane Aufstriche herstellen oder Kleidung tauschen.
Beim Training von Kompetenzen ist besonders darauf zu achten, dass die Handelnden viele Erfolgserlebnisse haben, um ihre Motivation langfristig aufrechtzuerhalten und zu fördern. Daher sollten wir im Voraus planen, welche Ziele wir mit einer Veranstaltung erreichen möchten. Aus psychologischer Sicht ist es sinnvoll, sich kleine Ziele zu setzen und den Weg hin zu einem nachhaltigen Lebensstil in kleinen Schritten zu gehen. So erhalten Handelnde häufiger positives Feedback über ihre kleinen Erfolge, was die Motivation und damit das Erreichen von Umweltzielen fördert.
In der Kampagne »Small Steps« wird die Relevanz kleiner Schritte bedacht. Darüber hinaus soll durch das Weiterreichen der kleinen Karten ein Gefühl der kollektiven Selbstwirksamkeit erzielt werden.

Es ist außerdem sinnvoll, Menschen, die Kompetenzen erwerben wollen, zum Fehlermachen zu ermutigen. Im Umgang mit den gemachten Fehlern sollten die Lehrenden dann strategisch und emotional unterstützen. Beim Gärtnern können z. B. Reflexionsgespräche über Schwierigkeiten geführt werden. Statt sich endlos über einen missglückten Anbau zu ärgern, wird so gemeinsam nach praktikablen Lösungen gesucht.
Wenn die Aufgabe einen gewissen Schwierigkeitsgrad besitzt, fördert sie uns darin, diese und ähnliche Aufgaben auch im Alltag kompetent zu lösen. Um den Alltagstransfer zu unterstützen, ist es z. B. wichtig, dass in einer Nähwerkstatt nicht nur vorbereitete Nähmaschinen bedient werden, sondern auch das Vorbereiten selbst gelernt wird. Das Erleben von Autonomie und eigener Kompetenz steht dabei im Mittelpunkt.
Auch die zeitliche Komponente ist beim Kompetenztraining zu beachten. Es sollte immer so geplant werden, dass die Fähigkeiten bald angewandt werden können. Biete ich beispielsweise einen vegetarischen Kochkurs für Kinder an, die zu Hause nie selbst das Essen zubereiten müssen, verliert die Aktion ihre Effektivität. Gestalte ich jedoch gemeinsam mit den Kindern ein ansehnliches kleines Kochbuch zum Mitnehmen für die Eltern und lege ihnen gemeinsames Kochen in der Familie nahe, werden die vegetarischen Kochfähigkeiten der Kinder langfristiger gestärkt.

Ein Kompetenztraining sollte:
- in kleinen Schritten vorangehen,
- viele Erfolgserlebnisse beinhalten,
- Fehler zulassen und konstruktiv reflektieren,
- ein angemessen hohes Aufgabenschwierigkeitsniveau haben, das einen Alltagstransfer zulässt und
- für zeitliche Nähe zwischen dem Training und der tatsächlichen Umsetzung sorgen.
Tipps zur Vermittlung von Handlungswissen
Relevanz und Nützlichkeit
Die Relevanz einer Handlung und die Nützlichkeit für die Umwelt und die Handelnden sollten bei jedem Kompetenztraining hervorgehoben werden.
Positiv- und Negativbeispiele
Handlungswissen und Kompetenzen werden leichter erlernt, wenn sie sowohl mit einem positiven als auch einem negativen Beispiel für ihre Umsetzung vorgestellt werden. In dem vorliegenden Handbuch wurde versucht, diesen Ansatz umzusetzen.
Vorwissen nutzen
Sich Vorwissen zunutze zu machen, wird häufig veranschaulicht mit den Worten »die Menschen da abzuholen, wo sie gerade stehen«. Erfrage ich z. B. bei einem Kompetenztraining zur Fahrradinstandhaltung das Vorwissen der Teilnehmenden, dann kann ich das gesamte Training am vorhandenen Wissensstand orientieren und so eventuelle Frustration bei den Teilnehmenden vermeiden.
Übertragbarkeit fördern
Schon bei der Vermittlung von Handlungswissen sollten wir auf die Anwendbarkeit im Alltag achten und diese durch systematische Vergleiche mit anderen Situationen erleichtern. Außerdem kann es hilfreich sein, wenn sich direkte Handlungen an eine Veranstaltung anschließen und Teilnehmende neu Gelerntes gleich praktisch erfahren können. Beispielsweise sollten Teilnehmende einer Kräuterwanderung zu einer bestimmten Pflanze nicht nur erfahren, welcher Salat sich damit zubereiten lässt. Der Leiter oder die Leiterin sollte gleichzeitig dazu anregen, über weitere mögliche Verwendungen der Kräuter nachzudenken. Wenn möglich sollten die Teilnehmenden zwischendurch Kräuter kosten können und am Ende z. B. gemeinsam einen Tee aus den gesammelten Kräutern kochen.
Einfache Veraltensweisen vorschlagen
Individuelle Verhaltensweisen, die keinen hohen Aufwand für uns bedeuten (wie z. B. Recycling an öffentlichen Mülleimern), lassen sich durch Vermittlung von Handlungswissen gut fördern. Für anspruchsvolle Verhaltensweisen sollte auf andere Maßnahmen wie z. B. Kompetenztraining zurückgegriffen werden.
Spezifische, auf den Handlungskontext zugeschnittene Infos
So sollte Information sein, damit Menschen sie verstehen, als glaubwürdig bewerten und ihr Vertrauen schenken. Bei der Wissensvermittlung zu Klimarisiken sollte darüber hinaus möglichst nüchtern und faktenbasiert argumentiert werden.
Handlungswissen sollte einfach und für die Zielgruppe relevant und nützlich sein.
Im Training sollte Handlungswissen auf Vorwissen aufbauen und Übertragbarkeit fördern, sowie Positiv- und Negativbeispiele enthalten. Im besten Fall ist es auf die spezifische Handlungssituation der Zielgruppe zugeschnitten.