Projektmethoden kennen lernen
Was ist ein Projekt?
Bevor wir uns näher mit dem Thema Projektmethoden beschäftigen, ist es wichtig, die ziemlich banal erscheinende Frage zu stellen: Was ist ein “Projekt”?
Tatsächlich gibt es sogar eine DIN-Norm, die – mit viel Interpretationspielraum – definiert.
“Ein Projekt ist ein Vorhaben, das im wesentlichen durch Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, wie z. B.: Zielvorgabe, zeitliche, finanzielle, personelle oder andere Bedingungen, Abgrenzungen gegenüber anderen Vorhaben und projektspezifische Organisation.“ (DIN 69901´)
Im Einklang mit unseren bisherigen Projekterfahrungen würden wir die DIN-Norm nach diesen 3 Ebenen auslegen.
Eine Erstsemesterakademie für Verantwortung in der Wissenschaft können wir demnach als Projekt bezeichnen, genauso wie einen Umzug oder eine Cocktailparty mit Freund*innen. Ein kontinuierliches Vereinsmanagement ist hingegen kein Projekt, da es keinen definierten Endzustand aufweist.
Ein Projekt ist ein einzigartiges, in sich abgeschlossenes Vorhaben mit einem konkreten Ziel.
Es ist zeitlich begrenzt, hat also einen klaren Beginn und ein eindeutiges Ende.
Ressourcen (Zeit, Geld, Personal) stehen zur Verfügung und lassen sich z.B. von laufenden Kosten und Bedarfen abgrenzen, die unabhängig vom Projekt sind.
Überraschenderweise ähneln sich die Kriterien der Projektmethode “SMART-KISS” in großem Maße den zuvor genannten DIN-Kriterien eines Projekts. Die Kriterien von SMART-KISS können dabei helfen, die Ziele eines Projektes sehr genau zu formulieren.
Wenn ein Ziel folgende Eigenschaften aufweist und es dabei trotz der vielen Informationen kurz und knackig bleibt, können wir es wahrscheinlich auch erfolgreich durchführen:
- spezifisch
- messbar
- attraktiv / relevant
- realistisch
- terminierbar
- keep it short and simple (KISS)


Die Anwendung dieser Methode ist ganz einfach – versuche ein Projektziel zu definieren, welches allen Anforderungen gerecht wird.
Wenn du es mit einer Gruppe nutzen möchtest, bietet es sich an, die Vorschläge kurz gemeinsam zu besprechen und zu überlegen, inwiefern alle Aspekte zutreffen.
Ein Projekt fängt mit einem klaren Ziel an – dieses kann auf ähnliche wie ein fester Name motivieren und zum Erfolg verhelfen.
Wofür braucht es Methoden?
Projektmanagement dient allgemein der Planung und Organisation sowie der Überwachung und Steuerung eines Projekts. Unter Management versteht man jede Handlungsweise, die dabei hilft, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Projektmanagement bezeichnet also alle Prozesse und Aktivitäten, welche ein Projekt zu seinem Ziel führen.
Projektmanagement-Methoden unterstützen diese Prozesse auf unterschiedlichen Ebenen. Sie helfen uns, den Verlauf und Erfolg eines Projektes maßgeblich zu beeinflussen.
Sie lassen sich ungefähr nach folgendem Raster kategorisieren:
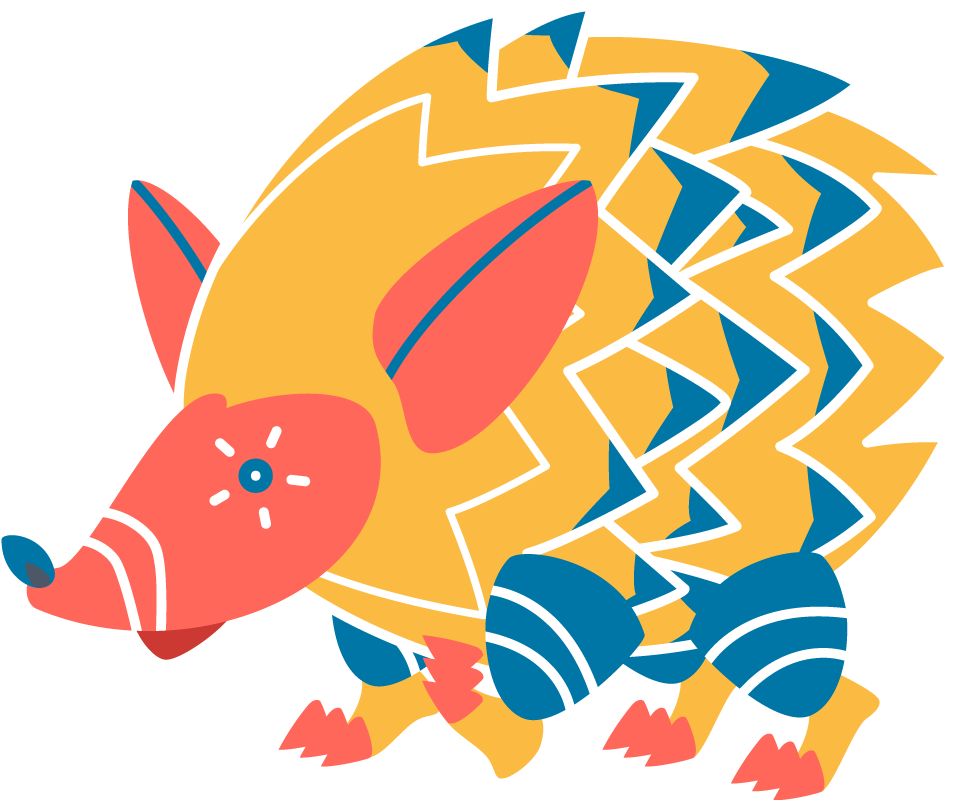
-
Strategie- und Projektentwicklung
Hier geht es um den übergeordneten Plan und das große Ganze. Die Methode der Zukunftswerkstatt fällt zum Beispiel in diesen Bereich. Weitere bekannte Methoden sind das Design Thinking, die Konzeptentwicklung bzw. Entwicklung von Vision und Mission Statement oder Dragon Dreaming. Diese "Methoden" beinhalten häufig eine bestimmte Herangehensweise und bedienen sich selbst vieler der anderen aufgeführten Methoden.
-
konkrete Projektplanung
Die konkreten Projekt-Planungsmethoden gehören zum täglichen Werkzeug in der Projektarbeit und strukturieren diese. Sie helfen den Überblick über alle anstehenden Aufgaben und Ressourcen zu behalten. Es gibt sie zu Hauf online zu finden, oft mit großen Versprechen. Immer im Kopf behalten: Die Methode muss zu eurem Vorhaben und Team passen. Konkrete Methoden sind hier zum Beispiel die Roadmap oder der Projektzeitstrahl (auch Gantt-Chart), die Projektcheckliste, diverse Projekt-Canvasse, Aufgabenlisten oder auch Kanban-Boards.
-
Präsentation und Öffentlichkeitsarbeit
Präsentation und Öffentlichkeitsarbeit in Form der Außendarstellung werden wir nochmal kurz als seperates Thema in der Toolbox anschneiden. Die Methoden die unter das Präsentatieren fallen, werden vor allem überall dort benötigt, wo Personen überzeugt werden sollen. Zu den Methoden gehören neben vielen rhetorischen und visuellen Kniffen auch Methoden die helfen hier eine Struktur hineinzubringen wie z.B. das AIDA Prinzip, Visualisierung, oder ein einheitliches Design (Farben, Schriften, Layout), das auch ganz rudimentär ausfallen kann.
-
Selbstmanagement
Unter Selbstmanagement fallen Methoden, die die individuelle Arbeitsweise der Projektmitglieder betreffen. Selbstoptimierungs-Ratgeber gibt es viele, aber es kann helfen, sich dazu auszutauschen was für euch gut klappt, um das Ehrenamt neben Studium und Nebenjob zu wuppen. Methoden sind zum Beispiel die Eisenhower-Matrix oder To-Do-Liste, aber auch Bücher wie "Der gute Plan" oder "Getting Things Done" können Anregungen geben.
-
Problem- und Potenzialanalyse
Dann gibt es eine Anzahl an Tools, die sich spezifische Aspekte in der Tiefe anschauen und analysieren. Dazu gehört zum Beispiel die SWOT-Analyse, die Einfluss-Interesse-Matrix oder die umfassenderen Methoden der Potenzial- oder Prozessanalyse. Diese Methoden sind rein analytisch und helfen IST-Zustände aufzuzeigen.
-
Teamarbeit
Ein Projekt ist immer nur so stark, wie das Team, das dahinter steht. Damit werden wir uns in der nächsten Woche noch vertieft beschäftigen. Auch hier wurden verschiedene Methoden entwickelt, um die Stärken und Rollen in eurem Team auszuloten. Dazu gehört zum Beispiel die Kompetenzfigur, Verantwortlichkeitsmatrix oder verschiedene Canvasse und Methoden um die Rollenverteilung im Team zu analysieren. Auch Kommunikationsübungen können darunter fallen. Bedenkt bei diesen Methoden immer, dass sie nur Hilfsmittel sind und keine Wahrheiten, sondern immer nur Hinweise bieten können, auf deren Basis ihr euch weiterentwickeln könnt.
-
Dokumentation und Berichte
Spätestens wenn es darum geht, über das erste Projekt hinauszuwachsen oder neue Mitglieder zur Gruppe kommen, ist es hilfreich das Wissensmanagement durch Methoden der Dokumentation oder Berichte zu ergänzen. Eine Berichtmethode für gemeinsame Treffen ist zum Beispiel der Sprint-Review, aber auch einfache (Ergebnis- oder Foto-)Protokolle können schon helfen, euren Austausch von Wissen zu strukturieren. Auch Wikis, oder Vorlagen für bestimmte Aufgaben oder Notizen und ein gemeinsames Ablagesystem dafür zählen zu diesem Bereich.


Schritt 1
Nimm dir Zettel und Stift und reflektiere 5 Min für dich zu deinem Verständnis von Projektmanagement-Methoden. Mache dir dabei Notizen z.B. in Form einer Mind-Map.
Was macht allgemein ein erfolgreiches Projekt aus? Welche Faktoren tragen dazu bei, dass ein Projekt wirkungsvoll umgesetzt wird? Welche Rolle können dabei Projektmethoden spielen?
Wie wird das Projekt eine runde Sache?
Auch Fuchs und Igel haben sich dieser Frage gestellt und gemeinsam zusammengetragen, was Projekte erfolgreich macht und welche Rolle dabei die Anwendung von Projektmethoden spielen kann.
Das Ergebnis kannst du in Auszügen unten lesen oder das Interview direkt über die Audiospur anhören.

Es gibt 3 Ebenen, die für Projekte wichtig sind:
Menschen: Was brauche ich, um überhaupt mitzuwirken und so ein Projekt auf die Beine zu stellen?
Organisationsstruktur: Wie muss die Organisation(-sstruktur) aussehen, damit mein Projekt erfolgreich ist?
Projektidee und -planung: Welche Eigenschaften braucht das Projekt/ die Idee, um überhaupt erfolgreich sein zu können?
Lass uns mit dem ersten Punkt beginnen: Ich möchte selbstverständlich Spaß bei meinem in der Regel ehrenamtlichen Arbeiten haben.
Das ist bei mir vor allem daran gekoppelt, dass ich beim Tun tatsächlich etwas lerne. Eine Aufgabe zum vierten oder fünften Mal zu machen langweilt mich. Innerhalb eines Projekts immer mal wieder Arbeitskreise oder Aufgaben zu wechseln könnte dabei helfen.
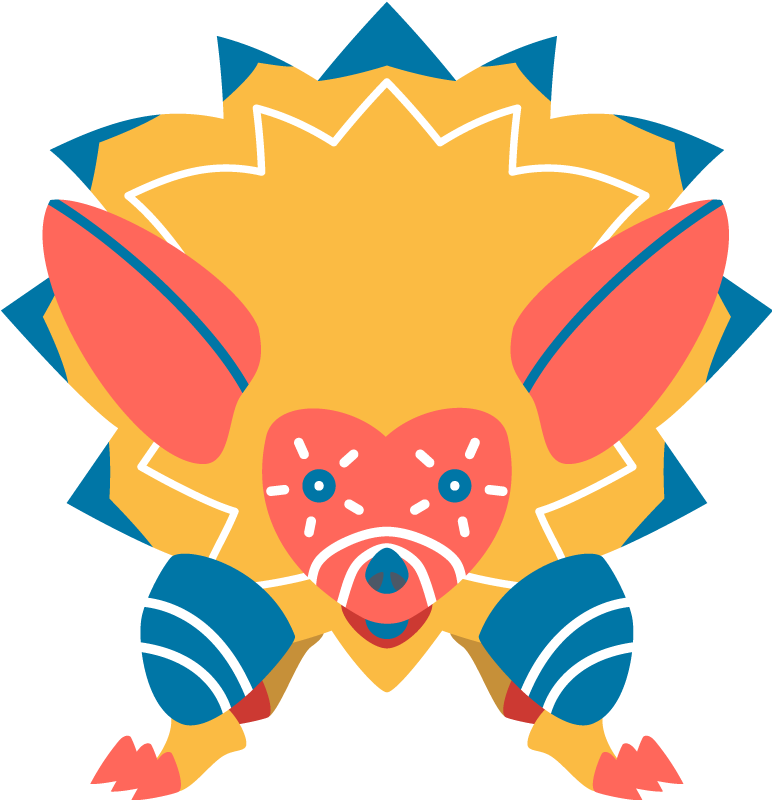

Da stimme ich voll zu! So könnte man es schaffen, dass Personen einem Projekt länger erhalten bleiben und die Idee und das Projekt wachsen kann, ohne dass Langeweile entsteht oder Wissen verloren geht. Außerdem muss das Umfeld stimmen. Eine noch so gute Idee ehrenamtlich mit einem Team umzusetzen, das ich nicht mag, ist schwierig. Nach dem Plenum oder in den Arbeitskreisen noch in lockerer Runde zusammenzusitzen oder zum Beispiel bei jemandem Zuhause gemeinsam zu kochen finde ich auch wichtig.
Dann würde ich jetzt auf die zweite Ebene eingehen: Die Organisation. Am Anfang ist jeder neu in einer Gruppe oder Organisation. Oft habe ich das Gefühl, sobald man sich eingelebt hat, vergisst man schnell wie es ist, neu dabei zu sein. Daher finde ich wichtig allen – und gerade neuen – Mitgliedern gegenüber offen für Veränderungen zu bleiben. Wenn immer die gleichen Personen alle spannenden Dinge an sich reißen, und ich nicht das Gefühl habe, dabei zu sein oder mit entscheiden zu können, verliere ich schnell die Lust.
Das sehe ich ähnlich. Die Haltung ist enorm wichtig. Ich merke sofort, ob eine Gruppe Interesse daran hat, sich weiter zu entwickeln und ob meine Ideen mit aufgenommen werden. Es braucht also ein stabiles Team, das Spaß hat und flexibel ist!
Für den dritten Aspekt – also neben der Organisationskultur, die stimmen muss und dem Gefühl, dass die Initiative auch ein bisschen mein Freundeskreis ist – möchte ich noch was zu den Aspekten, die das Projekt selbst betreffen, sagen. Das ist vielleicht weniger intuitiv, aber für mich sehr wichtig:
Ich möchte im Rahmen meines Ehrenamts wissen, für wen ich ich mir eigentlich die Arbeit mache. Oft habe ich das Gefühl, die Zielgruppe wird nicht definiert. Aber „Alle Studierende” sind aus meiner Sicht zum Beispiel eine sehr schlecht gewählte Zielgruppe.
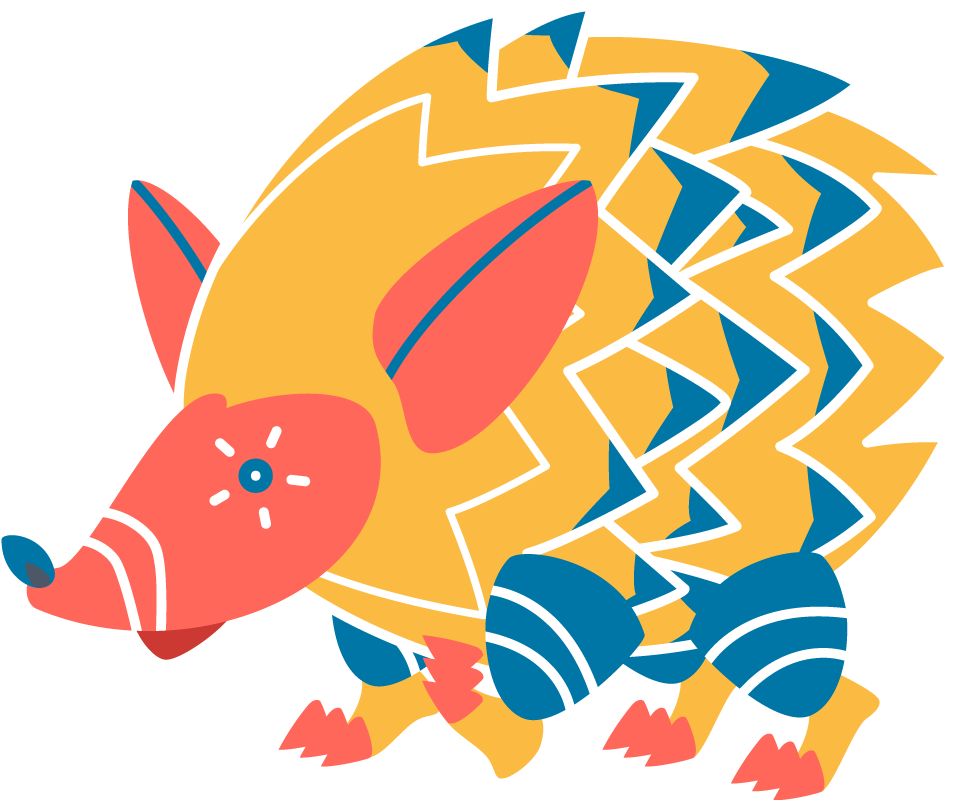

Apropos Ziele und Gruppe. Das Ziel selbst wird auch sehr oft vergessen! Was ist das Ziel einer Nachhaltigkeitswoche? Möglichst viele irgendwie zu erreichen? Dass mindestens 10 Personen danach in der lokalen Initiativenarbeit aktiv sind? Podiumsdiskussionen, sollen zum Nachdenken anregen oder, oder, oder? Soll die Hochschulleitung von uns erfahren und wenn ja, was bezwecken wir damit?
Achja, nicht zu vergessen, es ist ein Klassiker, aber er muss hier unbedingt erwähnt werden: SMARTe Ziele sind förmlich das A und O der Projektumsetzung!


Ahja, da sind wir also schon wieder bei den Projektmethoden gelandet. Was ist das eigentlich nochmal genau und brauche ich das wirklich?
Projektmethoden helfen dabei, die Ziele von Projekten zu erreichen. Sie strukturieren Planungsprozesse, ermöglichen eine Balance zwischen Kreativität und weitsichtigem Denken auf der einen Seite sowie Konkretisierung und Realismus auf der anderen.
Du brauchst das vielleicht nicht unbedingt, ich würde jedoch sagen, dass der Planungs- und Durchführungsprozess mittels Projektmethoden, die ja wie Stützen dienen, in jedem Fall angenehmer und effektiver wird. Vielleicht nutzt du auch bereits Methoden, ohne dir dessen wirklich bewusst zu sein? Ab einer gewissen Anzahl an Initiativenmitgliedern und Personen, die eingebunden werden oder einer gewissen Größe und Ferne des Ziels, z.B. das die Uni strukturell verändern will, bin ich mir ziemlich sicher, dass es ganz ohne Projektmethoden nicht klappen wird.
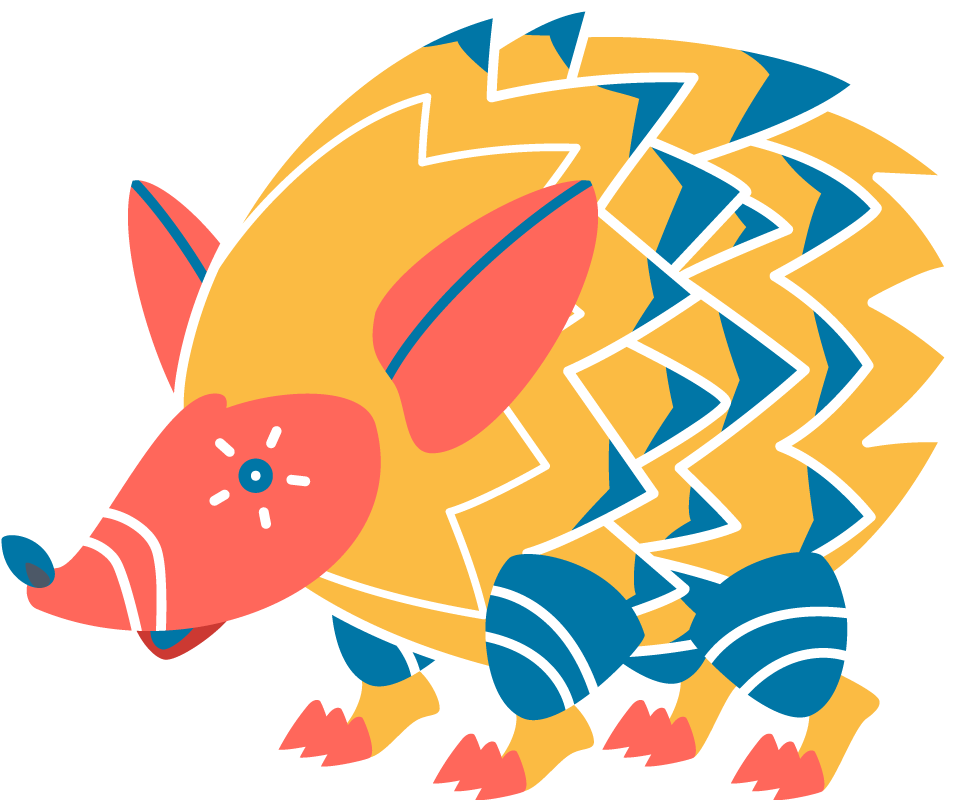

Zu Zielen fällt mir noch ein: In meiner Erfahrung werden in Gruppen Ideen gerne auch mal als konkurrierend wahrgenommen. Was ich in der ehrenamtlichen Arbeit gelernt habe, ist, dass nur weil ich eine Idee besser finde als eine andere, die andere dadurch nicht schlecht sein muss oder in Konkurrenz zu meinem Vorhaben steht.
Außerdem sollte wir uns in der ehrenamtlichen Arbeit doch vor allem da, wo Energie ist und Leute Dinge umsetzen möchten, untereinander supporten!
Zum Schluss möchte ich noch einen eher allgemeinen Gedanken loswerden, der für mich am Anfang ein bisschen um die Ecke gedacht erschien: Oft wird so getan, als ob es vollkommen offensichtlich ist, was die zugrunde liegenden Werte einer Gruppe sind.
Trotzdem fand es unglaublich hilfreich, diese einfach mal mit meinem Team auszusprechen und auszuformulieren. So wird einiges deutlicher und ich kann viel besser schauen, wer die Zielgruppe meiner Projekte ist und wen ich vielleicht gar nicht erreichen möchte oder muss. Das habe ich vor allem in der World Citizen School in Tübingen gelernt, von der ihr gleich noch mehr erfahren werdet.

Schritt 2
Nimm dir 5 Min und ergänze deine Mind-Map um weitere Aspekte, die dir dort bisher fehlen oder die dir im Laufe des Gesprächs eingefallen sind.
