Vernetzen mit Strategie
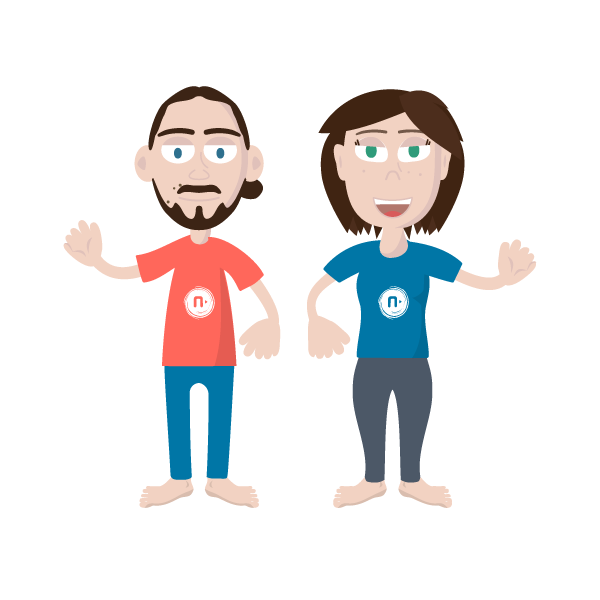
Halt, Stopp, Päuschen
Wir wissen, es ist wirklich verlockend, direkt durch die Module zu gehen und die Zeit wirklich voll dafür zu nutzen. Aber ohne regelmäßige Pausen geht die Konzentration auch schnell flöten.
Also gibt’s eine Pause! Ab in die Teeküche oder an die frische Luft, nimm dir den Moment für einen Schnack mit Freund*innen oder eine ordentliche Dehnung. Du suchst dir aus, wie du diese Zeit gestalten möchtest.
Verschiedene Wege führen zum Ziel
In den Aufgaben zur Vernetzung hast du bisher vor allem eine konstruktive Herangehensweise kennengelernt. Dabei werden Hochschulakteure als Kooperationspartner*innen vorausgesetzt und als Initiative oder Gruppe versteht ihr euch als Praxisakteur, der in der Durchführung und Planung von Projekten im aktiven Austausch mit Entscheidungsträger*innen steht.
Gleichzeitig kann es sich natürlich je nach Thema auch anbieten eher disruptiv und zum Teil auch radikal vorzugehen. Beim disruptiven Vorgehen werden vor allem Probleme oder Misstände in aller Klarheit benannt. Wenn überhaupt Forderungen gestellt werden, dienen diese dazu, um Druck aufzubauen. Viele Students for Future Gruppen an Hochschulen sind dafür ein präsentes Beispiel.
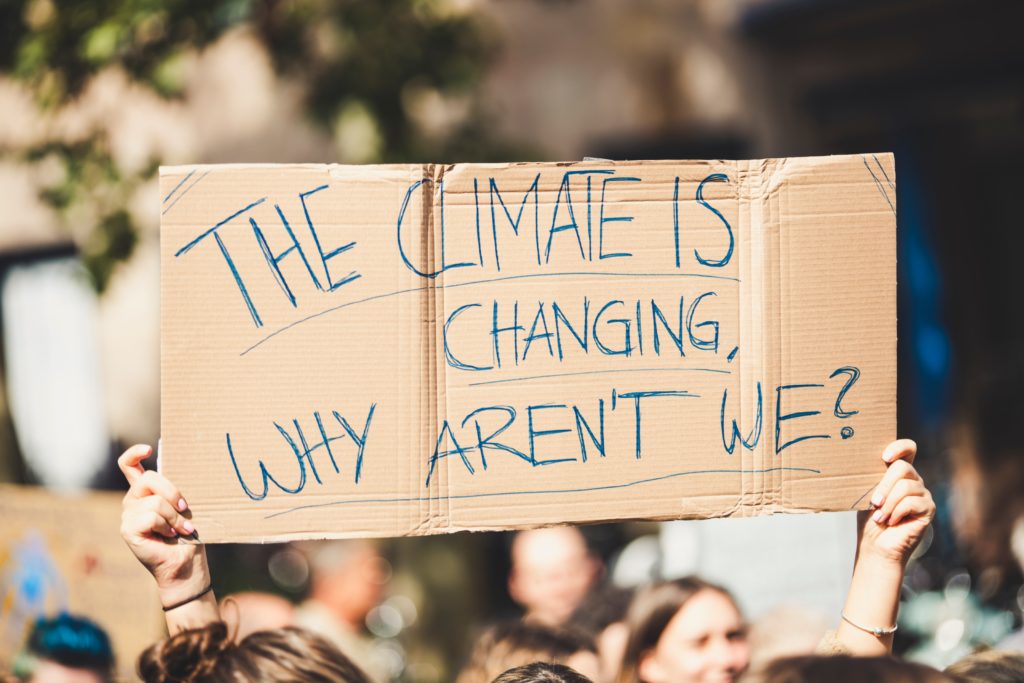
Disruptives und konstruktives Vorgehen konkurrieren jedoch nur vermeintlich miteinander. An verschiedenen for-Future-Gruppen kann man sehr gut erkennen, dass je nach Öffentlichkeitsarbeit und Interesse, zum Beispiel von den Rektoraten, disruptives Vorgehen in konstruktivem Vorgehen münden kann.
Inwiefern das gewünscht ist, ist natürlich eine andere Frage. Aber for-Future-Vertreter*innen, die in Gremienarbeit der Hochschulen, Stadtverwaltungen usw. mitarbeiten und eingebunden werden, sind ein gutes Beispiel für den Übergang von disruptiver zu konstruktiver Arbeit.
Wenn die Initiative, in der du tätig bist, eher konstuktiv unterwegs ist, schaut doch einmal, ob es sich nicht auch lohnt, euch mit Gruppen auszutauschen, die eine andere Herangehensweise haben. Oftmals kann eine Ergänzung beider Strategien sinnvoll sein, wenn z.B. einerseits eine studentische Vollversammlung zur Abstimmung über eine klimaneutrale Hochschule einberufen wird und andererseits ein Green Office Konzeptpapier auf den Weg gebracht werden soll.
Dazu kann auch die Studierendenvertretung vor Ort eingebunden werden, gerade wenn es darum geht, den Kontakt in die Ebene der Entscheidungsträger*innen zu nutzen, um z.B. gemeinsam beschlossene Forderungen zu übergeben.
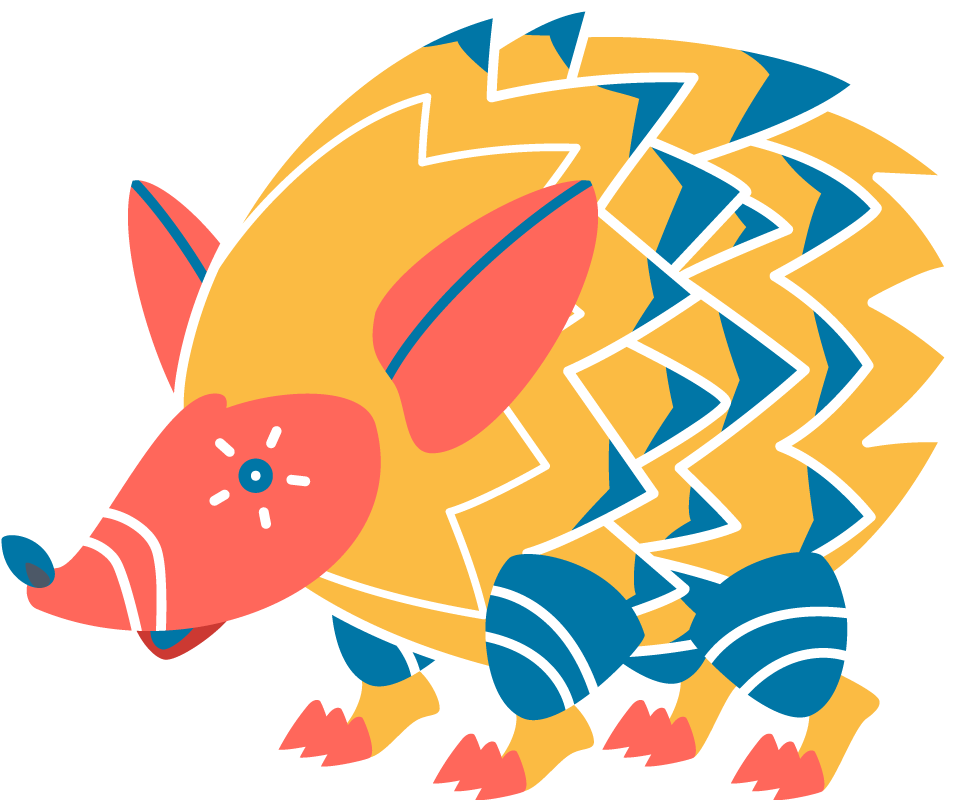

Aus der Umweltpsychologie wissen wir, dass es ich vor allem dann lohnt Probleme aufzuzeigen, wenn die Zielpersonen sich mit diesem Problem oder einer Thematik noch kaum beschäftigt haben.
Eine erste Sensibilisierung oder Bewusstmachung für ein Thema kann also durch aufzeigen von Problemen erzielt werden. Je nach aktueller Situation kann es sich aber ebenso anbieten, Lösungen vorzuschlagen. Gleichzeitig kann das Aufzeigen von Problemen eurem Ziel auch entgegenwirken (Abwehrhaltungen usw.).
Nutze also Werkzeuge wie die Einfluss-Interessen-Matrix und andere Stakeholder-Analysen, um die passende Vorgehensweise auszuwählen. Überlege immer wieder (gemeinsam), ob der gewählte Ansatz dem Ziel wirklich zugute kommt.
Ein Zusammenspiel der Vorgehensweisen
Eins darfst du nicht vergessen: Als Studierende*r bist du auch ein*e Expert*in an deiner eigenen Hochschule! Du kannst daher deiner Intuition beim Vorgehen auf jeden Fall folgen aber durch das zusätzliche Bewusstmachen der verschiedenen Methoden und Vorgehensweisen ist es viel einfacher, strategische Entscheidungen zu treffen, wie du für ein konkretes Projekt vorgehst.
Es lohnt sich, deine Kapazitäten und Ressourcen mit in die Entscheidung des Vorgehens einzubinden. Natürlich ist ein disruptives Vorgehen, bei dem du oder deine Gruppe ein Problem aufzeigt (z.B. ins Büro der Hochschulleitung stapfen und unangekündigt allen Dampf ablassen) weniger Arbeit als einen kleinen aber konstruktiven Beteiligungsprozess zu starten.

Außerdem gibt es ja die natürlichen Vebündeten, nämlich Unterstützer*innen (die in der Einfluss-Interessen-Matrix unten rechts stehen). Wie der Name schon sagt, lohnt es sich hier enge Kooperationen zu schmieden und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten.
Eine geplante Kooperation mit dem AStA könnte zum Beispiel so aussehen, dass als kleines Projekt Themen auf die Agenda und in die Öffentlichkeit gebracht werden und der AStA die gleichen Themen über die Gremienarbeit an die Entschiedungsträger*innen trägt.
So wirkt es für die Entscheidungsträger*innen so, als ob das Thema sehr viele Personen beschäftigt und man kann sie in die Zange nehmen.
Beispiel Divestment: Es ist unglaubwürdig, wenn der AStA in Gesprächen mit der Hochschulleitung droht, sofort mit der Info an die Presse zu treten, dass die Uni eine bestimmte Summe in Aktien eines großen Energiekonzerns hält. Wenn der AStA allerdings eine Initiative erwähnt, auf welche die Hochschulleitung durch ihr disruptives Vorgehen ggf. schon aufmerksam geworden ist, die genau dies aktuell plant, ist die Hochschulleitung mit wenig Aufwand schnell unter Druck.

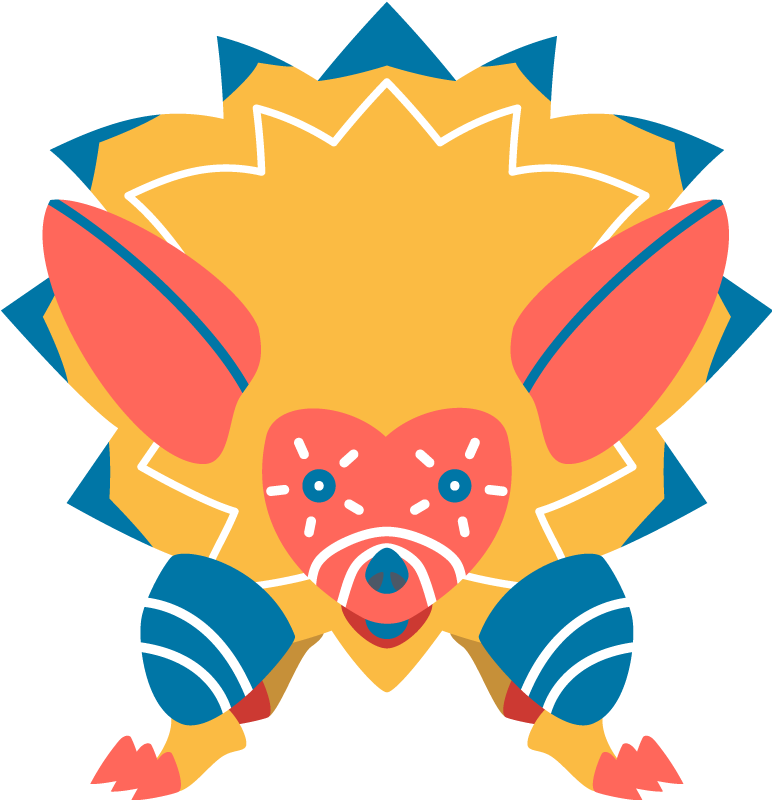
Versuche die Vorgehensweisen kreativ miteinander zu verknüpfen und Arbeitsteilung mit verschiedenen Akteur*innen durchzuführen. Dabei kann es sich auch lohnen, große Herausforderungen in kleinere Unterziele zu unterteilen. Dieses Vorgehen beschreibt man als…
Divide and Conquer
…und es ist vor allem für den Hochschulkontext mit seinen vielfältigen Statusgruppen spannend, da diese teilweise ähnlichere Ziele verfolgen als wir oft annehmen!
Nun bist du super darauf vorbereitet, dich mit den Akteur*innen an deiner Hochschule und drumherum gezielt zu vernetzen.
Schritt 7
Wir sind uns bewusst, dass Vernetzung auch mit physischer Interaktionen zu tun hat und sich das Ganze im digitalen Raum nicht immer so einfach gestaltet. Unsere Tipps beziehen sich auch auf Vernetzung, die über Mailkontakt und Videokonferenzen hinausgeht. Trotzdem möchten wir gerne von dir hören, wie du dich für dein aktuelles Projekt oder Vorhaben vernetzt und was deine Strategie ist. Beantworte dafür die Fragen im Thread.