Von Nachhaltigkeit an Hochschulen
Eine Frage der Definition?
Die studentische Variante
Zum Einstieg haben wir dir eine Kernaussage aus der Vision von netwerk n mitgebracht. Die Vision hat der studentische Verein 2015 formuliert und wir orientieren uns in unserer Arbeit und unserem Engagement daran.
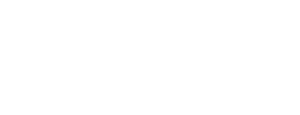
„Wir verstehen nachhaltige Hochschulen als lernende Institutionen. Sie hinterfragt partizipativ Ursachen heutiger und zukünftiger gesellschaftlicher und ökologischer Phänomene und akzeptiert und benennt Werthaltungen.
Sie sucht nach Möglichkeiten, Transformationsprozesse aktiv so zu gestalten, dass sie Folgen für heutige und nachfolgende Generationen berücksichtigt und abwägt.
Dabei regt eine Hochschule in und für nachhaltige Entwicklung zu kritischem Denken an und schafft Räume für Persönlichkeitsentwicklung der Menschen innerhalb und außerhalb der Institution Hochschule.“
Die Hochschulvariante
Ein anders Verständnis haben einige Hochschulen innerhalb des Verbundsprojekts HOCH-N festgehalten. Wenn du sie im Detail durchlesen möchtest, findet du hier die vollständige Version von Vogt et. al. (2020).

"Die Aufgabe der Hochschulen besteht darin, sich theoretisch-konzeptionell, methodisch und reflexiv mit den Prozessen und Bedingungen der gesellschaftlichen Transformation auseinanderzusetzen.
Gleichzeitig geht es auch darum, wie die ethische Dimension in der Wissenschaft (in den Handlungsfeldern Forschung, Lehre und Betrieb) berücksichtigt und umgesetzt werden kann.
Aufgeklärte Wissenschaft bedarf einer methodisch-kritischen Reflexion zum Stellenwert normativer Perspektiven. Deshalb analysiert Ethik die vielfältigen Gründe, Ziele, Motivationen und Widerstände guten und gerechten Handelns. Dabei erschöpft sie sich nicht darin, rezeptartig fertige Lösungen vorzugeben.
Vielmehr will sie zunächst zum Nachdenken anregen und dadurch zur Freiheit befähigen. Die Freiheit der Wissenschaft ist von daher stets als Auftrag zur eigenverantwortlichen Reflexion ihrer Ziele im Dienst einer zukunftsfähigen Gesellschaft zu interpretieren."
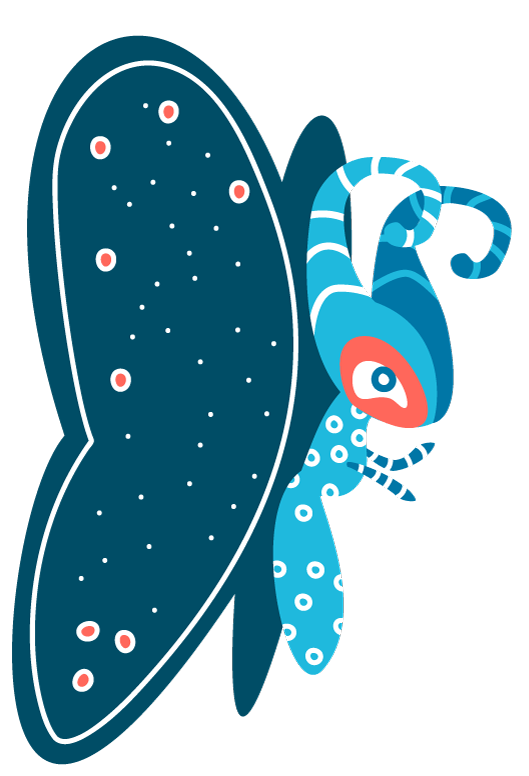
Was sagen "nachhaltige" Hochschulen dazu?
In Deutschland gibt es bereits Hochschulen, die sich seit einigen Jahren Nachhaltigkeit als Thema auf die Fahnen schreiben oder versuchen, sich selbst als Institution in die Richtung zu bewegen, eine ganzheitlich nachhaltige Hochschule zu werden.
Die Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde oder der Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier gehören dazu, aber auch die Leuphana Universität Lüneburg.

Da stellt sich die Frage – sind diese Hochschulen wirklich Nachhaltigkeitsleuchttürme? Was ist an ihnen so besonders?
Der AStA der Leuphana hat sich 2018 in einer kritischen Festschrift dazu positioniert. Mit dem Beitrag „Nachhaltigkeit: Ein gelebtes Handlungsprinzip an der Leuphana?“ (S. 164 – 171) stellen die Autor*innen das nachhaltige Leitbild der Universität in Frage.
Schritt 1
Lese dir die untenstehenden (teils gekürzten) zitierten Auszüge aus dem Beitrag des AStA Lüneburg durch. Überlege dabei, welche Position die Autor*innen beziehen. Würdest du ihren Standpunkt teilen? Kannst du ähnliche Tendenzen in deiner eigenen Hochschule beobachten?
Notiere die für dich wichtigsten Kritikpunkte auf deinem Zettel.
»Die Leuphana beschreitet den Weg der Nachhaltigkeit in Forschung, Bildung, gesellschaftlicher Partizipation und im Campus-Betrieb.« So zumindest steht es auf der Homepage der Universität geschrieben. Da wird nicht tief gestapelt. Die Universität sucht nicht etwa Wege zur Nachhaltigkeit. Nein. Sie beschreitet schon den Einen. Doch was genau heißt das?
2008 setzte sich die Universität in ihrem Entwicklungsplan das Ziel, eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete und als solche anerkannte Universität zu werden und den meisten Student*innen in Lüneburg wird es sicherlich wichtig sein, dass sich ihre Uni für Nachhaltigkeit einsetzt und eine Vorbildfunktion in dieser Hinsicht einnimmt.
Aber woran machen die Autor*innen dieses Zitats fest, was nachhaltig ist und was nicht? Und wie stellen sie fest, dass die Universität dem entspricht? Zumindest in den Vorlesungen und Seminaren zum Thema Nachhaltigkeit wird schließlich immer betont, wie schwer eine Definition der Nachhaltigkeit ist, geschweige denn ihre Umsetzung.

Im Nachhaltigkeitsbericht der Universität Lüneburg lässt sich einiges zu dieser Frage finden. Hier erfährt man etwa, dass die Universität im Bereich Bildung ihre Nachhaltigkeit an der regelmäßigen Qualitätsprüfung der Studienprogramme, der Gestaltung des Leuphana-Semesters, der Möglichkeit, Umwelt- und Nachhaltigkeitswissenschaften zu studieren, und dem studentischen Engagement festmacht.
Oder auch, dass im Bereich Forschung beispielsweise das Bekenntnis der Universität zu den Standards guter wissenschaftlicher Praxis, die partizipative Forschung, die Handlungsorientierung und die Internationalisierung als nachhaltig erachtet werden. Im gesellschaftlichen Bereich ist dann vor allem noch die Förderung von Unternehmensgründungen zu nennen. Außerdem werden die Nutzung von erneuerbaren Energien, Stromeinsparungen, Gender-Diversity-Zertifikate und Frauenquoten aufgeführt.
Das klingt schon sehr umfassend, aber während unseres Studiums der Nachhaltigkeitswissenschaft haben wir vor allem eines gelernt: über Nachhaltigkeit wurde und wird viel geredet – in den wichtigen Bereichen (Umweltzerstörung, Armut, Klimawandel etc.) zeigen sich bisher trotzdem keine nennenswerte Verbesserungen. Ein kritischer Blick lohnt sich also.
Wenn man sich derartige Nachhaltigkeitsberichte einmal oberflächlich anschaut, fällt zunächst auf, dass entgegen der vielerorts betonten Vielfalt an Nachhaltigkeitsdefinitionen überraschende Einigkeit darüber herrscht, was nachhaltig ist: erneuerbare Energien beispielsweise sind nachhaltig […]. Auch Bildung, ob in Form von Bildung für nachhaltige Entwicklung, einem Studium oder Weiterbildung, ist nachhaltig […]. Auch die persönliche und fachliche Weiterqualifizierung der Mitarbeiter*innen wird an der Universität gefördert, so dass seit 2010 die Weiterbildungsstunden kontinuierlich ansteigen.

Oder auch Partizipation ist nachhaltig. Kooperationen mit der Wirtschaft und die Beteiligung anderer Akteure aus der Gesellschaft an der Forschung in Lüneburg sollen die Wirkungskraft der Universität in die Gesellschaft tragen […]. Solche und ähnliche Maßnahmen findet man häufig in Nachhaltigkeitsberichten und auch die Universität Lüneburg stellt diese unter anderem als ihre konkreten Beiträgen zur Nachhaltigkeit dar. Und die Leser*innen des Nachhaltigkeitsberichts werden das wohl auch so sehen (müssen).
Damit wären wir wieder bei der anfänglich aufgeführten Problematik: es kommt auf das grundlegende Verständnis von Nachhaltigkeit an. Erneuerbare Energien beispielsweise haben zwar ohne Zweifel bestimmte Vorteile gegenüber Atomstrom oder aus Kohle gewonnener Energie, jedoch stellen sie nicht Strom zum ›Nulltarif‹ her: auch sie benötigen verschiedenste (nicht erneuerbare) Ressourcen, wie seltene Erden oder Landfläche, deren Nutzung schon jetzt sowohl zu sozialen als auch ökologischen Problemen geführt hat.
Grundsätzlich kann Nachhaltigkeit als eine mögliche zukünftige, vielleicht niemals erreichbare, sondern nur anzunähernde Gesellschaftsformation, also als Utopie verstanden werden, oder darunter alles gefasst werden, was eine Abkehr von zerstörerischen Lebens- und Produktionsformen verspricht, also als Weg zu weniger CO2, weniger Naturzerstörung, mehr sozialer Gerechtigkeit usw. Beide Ideen von Nachhaltigkeit können noch beliebig ausdifferenziert werden.
Deutlich sollte sein, dass es um tatsächliche sozial-ökologische Veränderungen geht und nicht nur diskursiv bestimmte Handlungen oder Produkte mit moralischen Werten aufgebläht werden.
So sind etwa die vorgeblich ›ökologischen‹ Lebensstile gerade unter den besser gebildeten Menschen, wie Student*innen, besonders häufig zu finden. Sie gehen jedoch zumindest im deutschsprachigen Raum oft einher mit einem höherem Einkommen, einem dementsprechend höheren Konsum und größerem ökologischen Fußabdruck verglichen mit dem der gesellschaftlichen, weniger gebildeten (und konsumorientierten) Basis.

[…] An den Themen-feldern des Nachhaltigkeitsberichts der Universität lässt sich […] gut zeigen: es geht vor allem um Effizienz. Man verbessert die Qualität der Studienprogramme, um mehr Wissen in der gleichen Zeit zu vermitteln. Man fördert studentisches Engagement, um breiter ausgebildete Student*innen hervorzubringen. Man fördert die Partizipation von Praxisakteur*innen, um effektivere Lösungen zu finden. Man spart Strom und bietet dennoch gleichbleibende Leistung.
Man baut ein zwar energieeffizientes aber in seinem Design wenig zweckmäßiges, neues Zentralgebäude für mehr Prestige, was langfristig bessere Student*innen und Mitarbeiter*innen anlockt. Man fördert die Gesundheit, Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter*innen für »ein gesundheitsförderndes Betriebsklima, welches die Basis für die Leistungsfähigkeit und Kreativität der Hochschulmitglieder ist«.
Hier droht Nachhaltigkeit zum reinen Instrument im Wettbewerb zu verkommen, zum bloßen Anreiz für mehr Effizienz und Leistungsbereitschaft der involvierten Individuen, zum Zwang zu Selbstoptimierung im Namen des Allgemeinwohls.
Es ist der Kontext, der solche und ähnliche effizienzorientierte Nachhaltigkeitsmaßnahmen wirkungslos oder sogar destruktiv werden lässt. Erneuerbare Energien im Kontext einer Wachstumsgesellschaft verschieben beispielsweise die Probleme nur, denn sie ändern nichts an der Dynamik: möglichst hohe Einnahmen mit möglichst wenig eigenen Kosten erzielen, um im Konkurrenzkampf zu bestehen – das geht immer zu Lasten von Mensch und Natur. Denn was kostet unsere ›Nachhaltigkeit‹ eigentlich die Menschen des globalen Südens? Ihre Gesundheit? Ihre Lebensgrundlage?
Auch in Sachen Nachhaltigkeit gut ausgebildete Student*innen konsumieren vielleicht nachhaltigere Produkte und stehen im Konkurrenzkampf auf dem Arbeitsmarkt besser da, das ändert aber nichts am prekarisierten Arbeitsmarkt und wahrscheinlich auch nichts an ihrem ökologischen Fußabdruck. Wenn man genauer hinschaut, verpuffen so nicht die Nachhaltigkeitsmaßnahmen der Universität durch sie überlagernde und nicht angesprochene Praxen und die (in-)direkte Aufrechterhaltung der grundlegenden Probleme?

Ein kontext-spezifisches, kritisches und ganzheitliches Nachhaltigkeitsverständnis ist also ein möglicher Anfang auf dem Weg zu einer nachhaltige(re)n Hochschule. Dazu gehört aber noch weitaus mehr – z.B. die Probleme konkret zu benennen.